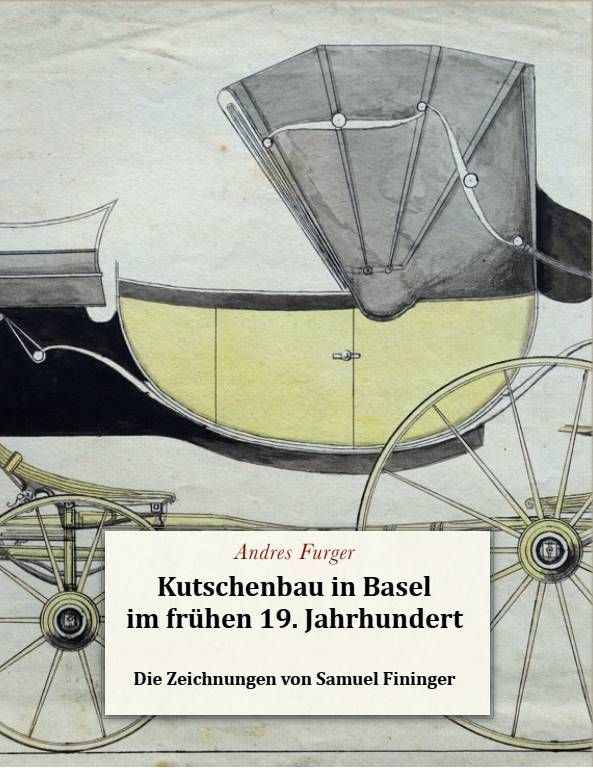C1: Wie kommt man auf Pferd und Wagen?
Die Einrichtung eines Kutschenmuseums bei Basel war für Andres Furger der Beginn der fachlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Pferd und Wagen. So, wie der Archäologe nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen arbeitet, schloss auch in diesem neuen Forschungsfeld eine Kombination von manueller und geistiger Arbeit an.
Anfangs 1981 im Historischen Museum Basel: Der Direktor ruft Andres Furger in sein Büro und drückt ihm einen Schlüsselbund in die Hand. «Das sind die Schlüssel zum Kutschendepot, schauen sie sich dort um, sie müssen ein Kutschenmuseum einrichten, viel Zeit haben wir nicht.»
Erst kurz zuvor hatte Furger dort eine Stelle als Kurator angetreten. Er machte sich also auf ins Depot und stand zunächst etwas ratlos vor den magazinierten Kutschen und Schlitten, die alte Basler Familien in vergangenen Jahrzehnten dem Museum geschenkt hatten.
Bald wurde klar, dass der Auftrag ernst zu nehmen war. Dahinter stand Hans Meier, Direktor der einflussreichen Christoph Merian Stiftung. Er hatte die eben zu Ende gegangene Schweizer Gartenbauausstellung «Grün 80» im nahen Brüglingen initiiert. Nach deren Ende wurde die historische Scheune gegenüber dem Pächterhaus bei der Merian-Villa leer geräumt.
Meier hatte die zündende Idee, innerhalb des neuen Botanischen Gartens ein Museum für Kutschen und Schlitten entstehen zu lassen, damit die Besucher des Merian-Parks bei schlechtem Wetter auch etwas Kulturelles geboten werden könne. Es blieben nur wenige Monate, sich mit dem Thema historische Fuhrwerke vertraut zu machen. Damals war die Vergangenheit Basels als Stadt der schönen Pferde und herrschaftlichen Chaisen noch etwas lebendig und entsprechende Unterstützung in Aussicht (dazu auch C0 «Fahren und Forschen»).
Die Eröffnung des Kutschenmuseums in Brüglingen
Im Frühjahr 1981 wurden die Kutschen und Schlitten aus dem Depot nach Brüglingen transportiert und dort im Erdgeschoss der historischen Scheune aufgestellt. Weitere Wagen kamen aus dem ehemaligen Besitz Alexander Clavels vom Wenkenhof dazu, darunter sein rotbrauner Phaëton mit Halbverdeck. Hintergrundwissen zum neuen Thema vermittelten älteren Basler Carrossiers wie Alfred Heimburger, Alfred Kölz oder Alfred Köng, die in der Jugendzeit selber noch die Zeit des Kutschenbaus miterlebt hatten. Sie gaben bereitwillig Auskunft. Dazu kam die Hilfe vom damals besten Sammler und Kenner alter Kutschen der Schweiz, Robert Sallmann in Amriswil.
Pünktlich konnte die Eröffnung stattfinden; vor der Museumsscheune standen vier angespannte historische Wagen. Damals wurde Kutschenfahren eben eine aufstrebende Sportdisziplin der FEI, Schweizer der Berner Militärpferde-Anstalt (EMPFA) waren führend mit dabei. Am Eröffnungstag des neuen Museums fuhren also die Gespanne zweier Landwirte, des Fahrsport-Präsidenten und eines jungen Fahrer namens Daniel Würgler vor.
Das weckte bei Andres Furger Kindheitserinnerungen und begeisterte ihn. So kam es zum Fahrunterricht in der EMPFA in Bern, im Nationalgestüt von Avenches und beim genannten Daniel Würgler im Leimental, der bald ein internationaler Viererzugfahrer wurde.
Mündliche Überlieferungen
Das Echo auf die Museumseröffnung war gut, auch in der Presse. In der Folge kam es zu zahlreichen Schenkungen, neben Fahrzeugen auch von Dokumenten und Photographien. Die hier Abgebildete zeigt eine Werkstatt mit dem Wagner Alfred Köng (mit Planrolle). Er war der Vater des schon genannten Carrossier Köng, der mit die schönsten Autokarosserien der Schweiz gebaut hatte (darunter den heute in Mülhausen stehenden Bentley von Alexander Clavel). Dieser hatte seine Karriere, die ihn bis nach Detroit in Amerika führte, in der Werkstatt des Vaters begonnen. Darüber berichtete er: «Ich habe mein Formempfinden in der Ausbildung bei meinem Vater herausgebildet. Am Anfang durften wir Lehrlinge nur Räder machen. Bei der Anfertigung der Speichen mittels des Ziehmessers bläute mir mein Vater präzis ein, wie die vordere gerade Fläche, Spiegel genannt, mit einer Kante von den sanften Rundungen abgesetzt werden musste. Das schulte mein Auge fürs Leben, jede Speiche ist eine kleine Skulptur!»
Rechts der Wagnermeister Alfred Köng in der Wagenschmiede Letzkus in Basel um 1900
Das Kutschenmuseum im Botanischen Garten zog nach und nach viele Interessierte an. Dazu gehörte eines Tages Rudolf Meier-Börlin, der sich als «letzten Basler Wagenmaler» vorstellte. Er war bereits über 70 Jahre alt und gesundheitlich etwas angeschlagen, seine Augen begannen vor den alten Wagen aber zu leuchten. Über seine frühere Arbeit ausgefragt begann er flüssig zu berichten. Schliesslich anerbot sich Meier, wieder tätig zu werden. In einer Ecke der Museumsscheune wurde eine kleine Werkstatt eingerichtet. Eine soeben angekaufte Kalesche der Zeit um 1820 war in einem so schlechten Zustand, dass die alte Bemalung nicht zu retten war. Diese Kutsche nahm er sich vor, begann zu schleifen und zu spachteln. Schliesslich folgte die Neubemalung nach den vorgefunden Farbresten. Voll ins Element kam er bei der Linierung als letztem Akt. Er brachte seine langhaarigen Schlepperpinsel von zu Hause mit, tauchte sie mit zittriger Hand in die rote Farbe auf der Palette und zog schliesslich mit routiniertem Zug die feinsten Linien auf die lackierten Flächen. Kaum angesetzt, wurde die Hand ruhig, wie in alten Zeiten. Er gehöre schliesslich noch zum alten Schlag der Handwerker, die früher «mit den Augen stehlen mussten», wie er meinte. Schliesslich konnte Meier überredet werden, einige Geheimnisse seines Handwerks preiszugeben; er verfasste 1982 eine Broschüre mit dem Titel «Die Handlackierung alter Kutschen, Schlitten und Autos», die im Museum erfolgreich verkauft wurde.
Der Wagenmaler war nicht der einzige, der interessante Geschichten zu erzählen wusste. Es konnten auch alte Basler für den freiwilligen Museumsdienst verpflichtet werden, die den Besuchern bereitwillig über die alten Zeiten Auskunft gaben. Zu diesen Zeitzeugen gehörte der ehemalige Oberleutnant Iselin, der im Zweiten Weltkrieg noch sein Dienstpferd vor seinen Dogcart gespannt hatte. Oder die Nachkommen aus den beiden Droschkenanstalten Keller und Settelen öffneten bereitwillig ihre Archive. So kam in kurzer Zeit einiges Wissen zusammen, das 1982 in einem Büchlein mit dem Titel «Kutschen und Schlitten aus dem alten Basel» der Stiftung für das Historische Museum Basel veröffentlicht wurde (digital abrufbar unter B7 "Kutschen und Schlitten aus dem alten Basel").
Epilog
«Gerissener Faden zur Kutschenzeit? Im Herbst 2016 wurde das Kutschenmuseum in Brüglingen sang- und klanglos geschlossen. Die historischen Fahrzeuge verschwanden im Museumsdepot.»